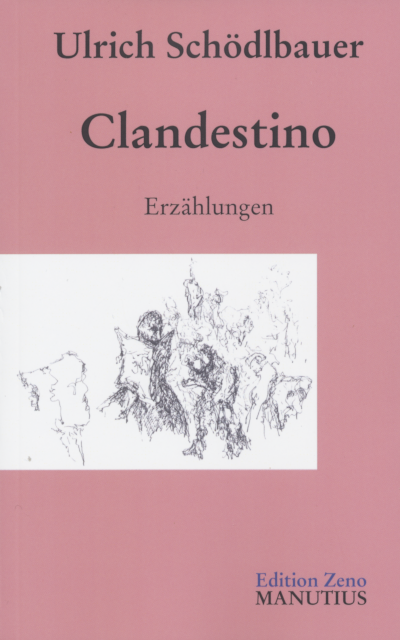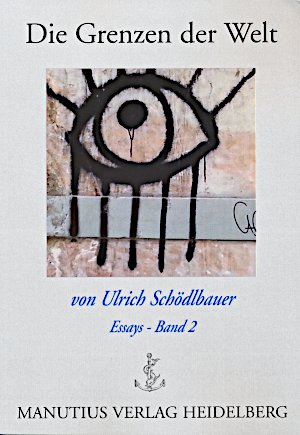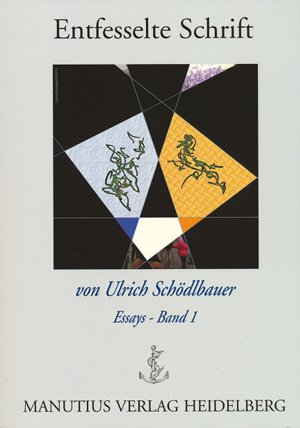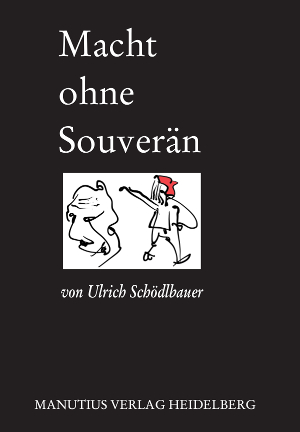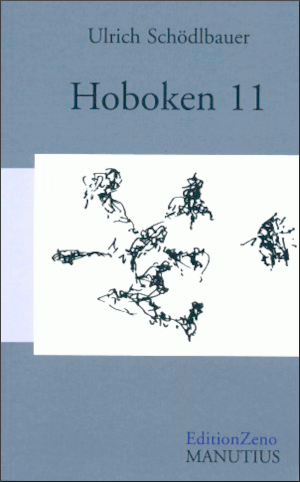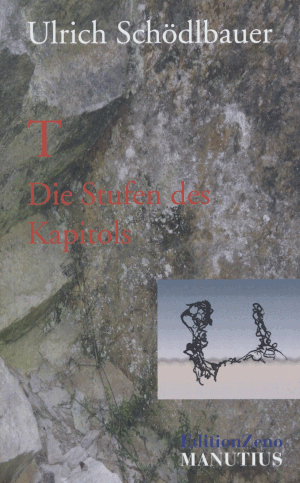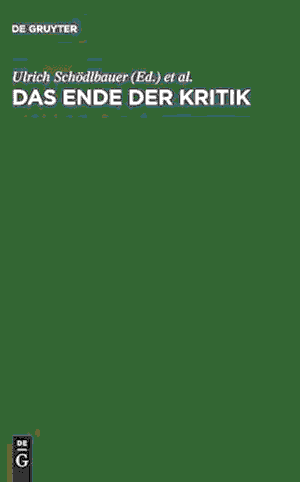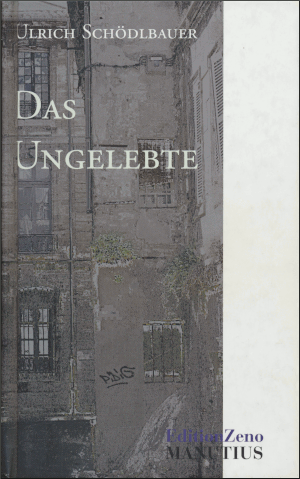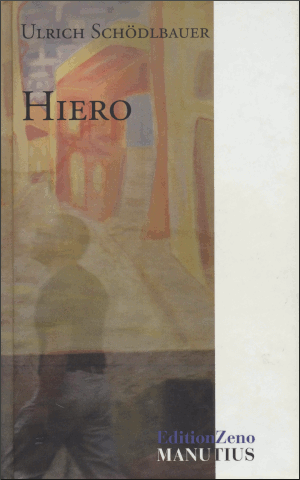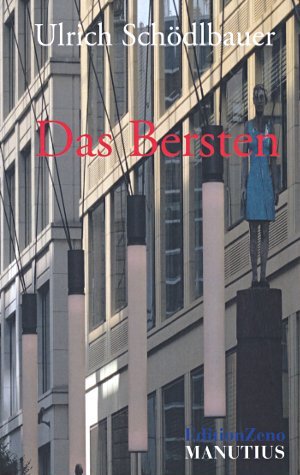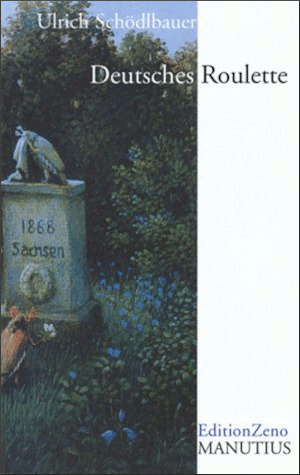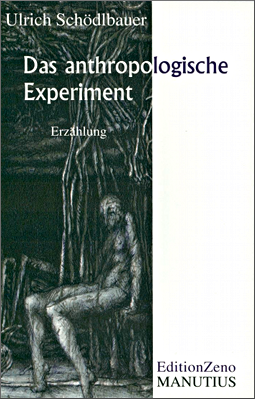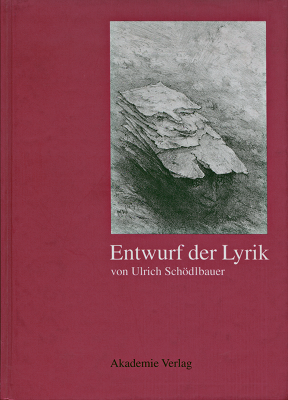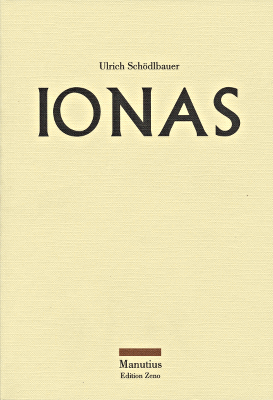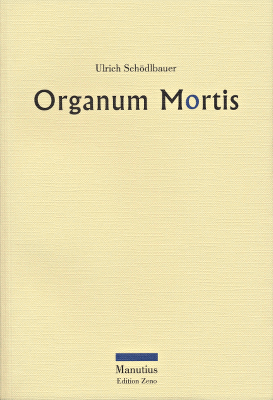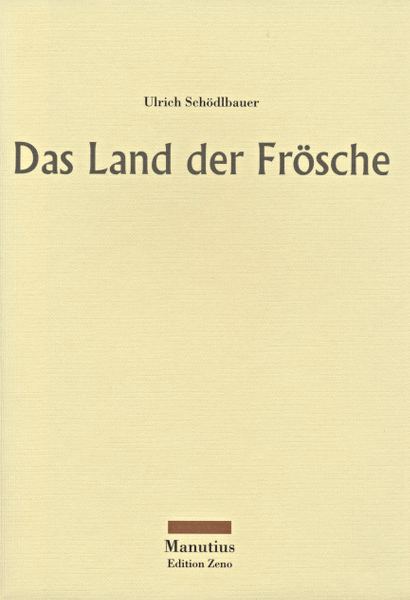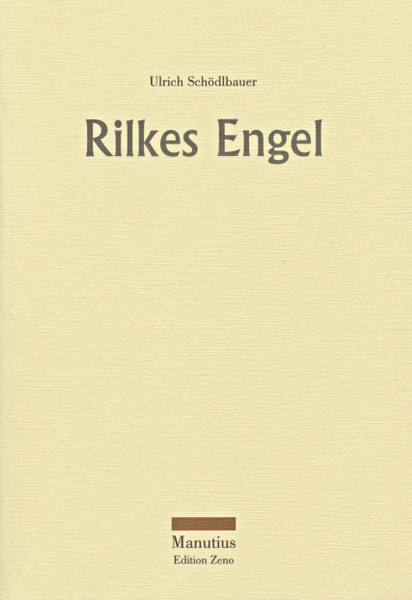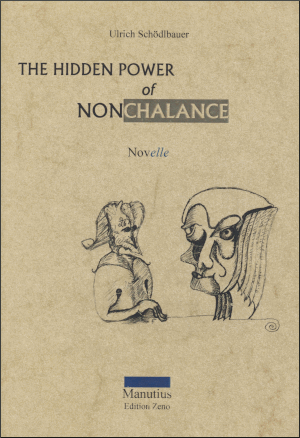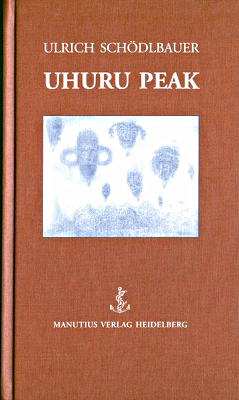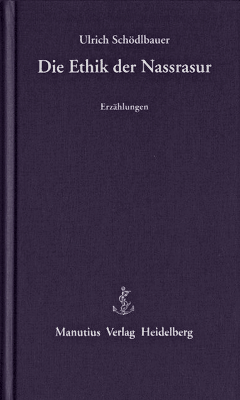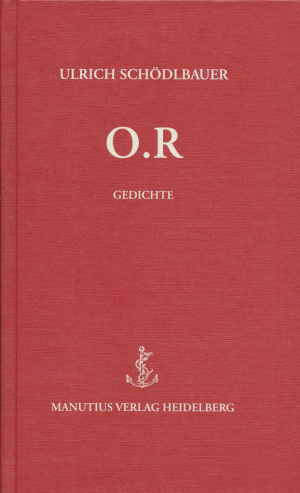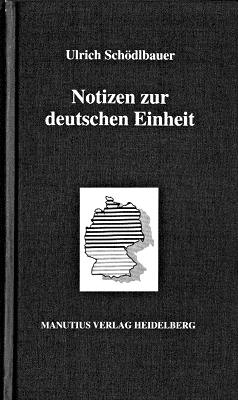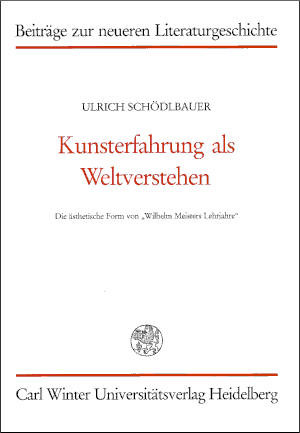Erste Lektion: Der Yagir ist die Gesellschaft.
Zweite Lektion: Der Yagir ist das Leichentuch der Gesellschaft.
Die erste Lektion handelt von Identität. Zweifellos ist der Yagir mit sich identisch. So kann es kommen, dass ein Gefangener (oder Freiwilliger, was auf dasselbe hinausläuft) des Yagir wie Justus etwas zu greifen meint, wenn er sich in die Pose des Aggressors begibt: als Angreifer spürt er den Widerstand stärker, hinter dem sich, wie hinter einem Vorhang, der Gegenstand regt, auf dessen angenommene Gegenwart er reflexhaft reagiert. Zweifellos treibt ihn dieser Zirkel langsam und stetig ins Irreale, ablesbar an der Häufigkeit seiner unmotiviert erscheinenden Ausbrüche. Schon länger sieht Herma dem zu und Traurigkeit füllt ihren Blick, sie erkennt, in welch aussichtslose Lage er sich manövriert hat (nicht ohne dabei Anleihen bei der eigenen, ähnlich vertrackten Situation zu nehmen), sie sieht die Männer, mit denen er sich umgibt, die meisten in vergleichbarer Lage, vergleichbaren Stimmungen unterworfen, ihr Zorn steigert sich zur Verachtung, von der auch ein paar Funken auf Justus niedergehen. Muss er sich gerade mit diesen Menschen treffen? Welchen Nutzen soll das haben? Sie wäre nicht Herma, wäre sie nicht besessen von der Idee des Nutzens, in gewisser Weise kommen die Ehepartner in diesem Punkt überein, aber nur in gewisser Weise – seine Kosten-Nutzen-Rechnung sieht radikal anders aus als die ihre und sie hält ihn für einen fool.
Die zweite Lektion handelt vom Verschwinden der Identität. Nichts anderes bezweckt ›M‹s eisernes Regime. Aus der Fernperspektive könnte man sie für eine landfremde Regentin halten, die sich, geschüttelt von Sehnsucht nach dem unzugänglich gewordenen Land ihrer Herkunft, ihr eigenes Staatsvolk schafft, indem sie das bestehende zerrüttet. Doch im Näherrücken löst sich diese Anmutung auf und es entrollt sich das Bild einer Menschenweide ohne Staat und Volk, ohne Kopf und Seele gewissermaßen, doch erfüllt von Kopfschmerz und Psycho-Elend, ein Eldorado für politische Gimpelfänger und Therapeuten. Exakt dieses Bild steht Justus alle Tage vor Augen und animiert ihn zum Schreiben. Ja sicher, auch Justus besitzt eine anima, eine Schreibseele, in der das Ungesagte als treibende Kraft die ihm zu Gebote stehenden Wörter nach vorne schiebt, ohne Rücksicht auf private Verluste, sogar ohne Rücksicht auf sein Verhältnis zu Herma, das er als leidend empfindet, weshalb er sich öfter als nötig an sie wendet, um eine Zustimmung heischend, die ihm nur verhalten, modo homoeopathico, zuteil wird. Was Herma in Wahrheit sieht, wenn ihr Gatte sich ihr gedankenvoll zuwendet (denn tiefer reicht ihr Blick nicht), ist dieser zutiefst unsichere Mensch, dem nicht wirklich zu helfen ist, jedenfalls mit den ihr zur Verfügung stehenden Instrumenten. Und sie beginnt seine Männerfreundschaften, wie sie sie bei sich verächtlich nennt, langsam aber sicher zu hintertreiben.