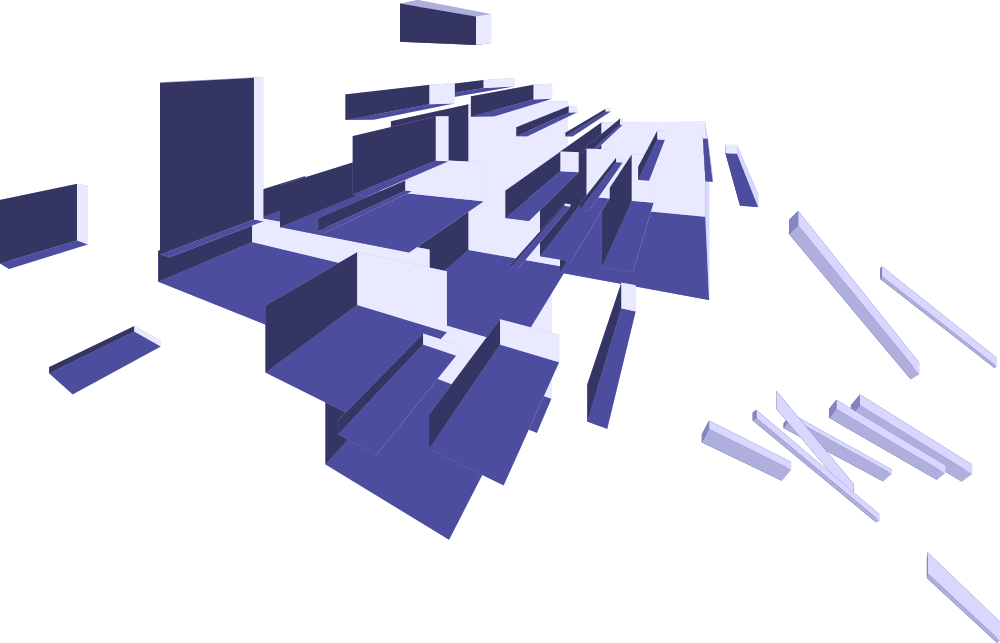1.
Am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts rangiert Jorge Luis Borges (1899 – 1986) neben Goethe, Joyce, Kafka als ein Stern erster Ordnung, der die Hamsuns und Becketts seiner Zeit hinter sich gelassen hat. Die Frage, warum das so ist, erhellt einen denkwürdigen Sachverhalt. Borges’ Erzählungen – die Gedichte sind otra cosa – benötigen keine literarische Szene, um ihre Wirkung zu entfalten. Ihnen genügen die Existenz von Literaturseminaren und das ABC des hermeneutisch geregelten Lesens, das dort gelehrt wird, Bedingungen also, die sich überall auf dem Erdball auf bürokratischem Wege herstellen lassen und allerorts längst vorhanden sind. Die Borges-Konjunktur profitiert von der Voraussetzungsarmut einer Institution, die sich mancherlei Geister dienstbar gemacht hat. Nichts erscheint dauerhafter.
Warum er und nicht ein anderer – irgendein anderer? Anhaltspunkte sind rasch aufgezählt: der biographische Kitzel, der von der Gestalt des langjährigen blinden Direktors der Nationalbibliothek in Buenos Aires ausgeht, der legendäre Ruhm seiner frühen Jahre, der sich mit dem hispanoamerikanischen Aufbruch in der Literatur verbindet, nicht zu vergessen die unverwechselbare Machart der Texte und ihre beruhigende Kürze. Daneben finden sich Gründe, die dem Betrieb schmeicheln. Dieser Schriftsteller ist ein Anachoret des Bibliothekswesens und der literarischen Recherche. Niemand hat so nachdrücklich auf seine und anderer Leute Lesefrüchte gesetzt wie er, niemand so selbstverständlich die verschiedenen Formen der Lektüre schreibend aufgegriffen, mit ihnen seinen Scherz getrieben, sie ins Märchenhafte entrückt und durch mancherlei metaphysische Paradoxien und mystische Figuren, mit rascher oder stockender Handbewegung präsentiert und wieder zerstreut, über die wissenschaftlich erlaubte Rede hinausgehoben. Die Grandezza des alten Mannes verschränkt sich auf wundersame Weise mit der Morbidezza eines pausbäckig betriebenen akademischen Dekonstruktivismus.
Es gibt viel Abwehr in der Bewunderung, die diesem Autor zuströmt. Borges who? Eine verzeihliche, eine irgendwann unvermeidliche Frage. Eine überdies, auf die es keine Antwort geben dürfte. Nietzsches Kunst der Oberfläche, hier ist sie weit über jeden Augenschein gediehen. Natürlich weiß das Borges auch. Der Schüler, den Paracelsus zurückweist, tut gut daran, zu gehen; Paracelsus, der hinter seinem Rücken die Rose aus der Asche zurückgewinnt, ist einer, der es nicht lassen kann. Ihm reicht ein Schuß Unsicherheit, eine kleine Schwäche des Intellekts, um den Hokuspokus in Gang zu setzen. Was der andere erleben darf, ist die verbale Vorbereitung des Unerklärlichen: ein wenig umständlich, ein wenig altertümlich, ein wenig unverständlich, aber aus Büchern vertraut, auf denen der Staub der Jahrhunderte und der Bann aufgeklärter Rechthaberei liegen. Niemand soll den Meister festlegen. Besser, als Scharlatan zu gelten denn als Magier zur falschen Zeit.
2.
Versucht man, den Punkt zu bestimmen, an dem die in diesem Band versammelten Erzählungen Die Rose des Paracelsus und Blaue Tiger zusammentreffen, so stößt man rasch auf das Wechselspiel zwischen einer Suche und einer Entdeckung. Der Lebenstraum der Nachfolge, der den Schüler in die Studierstube des Paracelsus geraten läßt, und die Fahndung nach dem blauen Tiger, die den Logikprofessor in die indische Provinz entführt, enden mit einer vorhersehbaren Enttäuschung und einem überraschenden Fund. Was immer sie suchten, es wird ihnen verweigert. Der gesunde Menschenverstand ist gehalten, ihnen zu sagen, daß Gaukelbilder sie gefoppt haben. Dennoch gewinnen sie: der Schüler seinen Verstand, der Professor eine Wirklichkeit, die über jeden Verstand geht. Beide erfahren die Trostlosigkeit des Wunders in praktischer wie in metaphysischer Hinsicht. Was den Schüler zurechtrückt, verstört den Lehrer.
Beide Erzählungen leben in Erwartung der abschließenden Geste. Daß nichts weiter geschehen wird, liegt früh auf der Hand. Ein Häufchen Asche, eine Handvoll Scheiben – die Frage ist, wie sich einer aus der Affäre zieht, dem das Mysterium des All-Einen auf der Seele lastet. Der Schüler hat seine Zeit noch vor sich. Der Aufschub, um den er bittet, ist für einen wie Paracelsus tödlich. Denn dieser hat keine Zeit. Allein mit sich selbst, das heißt, dem Leser, muß er umstandslos das Wunder vollbringen, das die Dazwischenkunft des Schülers herausgefordert und unmöglich gemacht hat. Die wiedererstandene Rose des Paracelsus ist das Signet seiner papierenen Existenz. Der Professor hingegen hat Zeit; nur nicht genug. Die Zeit drängt, sie mündet in eine Bedrängnis, die sogar die Frist des Vergessens im voraus bemißt. Dem wachsenden Elend begegnet der blinde Bettler, der das Problem entsorgt. Die Hand, die dem Meeresgrund gleicht, nimmt als Almosen an, was anders schwer zu beseitigen und noch schwerer zu tragen wäre – den fabelhaften Rand der Dinge.
Der Schriftsteller als gefoppter Magier, der weiß, daß seine Künste gegen die Macht der Interpretation nicht ankommen, als blinder Bettler, der im Morgendunst zergeht, nachdem er das Elend der Ratio als Gabe in Empfang genommen und also zu dem seinen gemacht hat – das sind Bilder, die unsere Aufmerksamkeit nicht übermäßig erregen, weil die Information, die sie enthalten, weithin die Gehirne in Beschlag nimmt. Zwecklos ist es deswegen nicht, sie hin und wieder mit Aufmerksamkeit zu bedenken. Auch was Gemeinplatz ist, mußte einmal erobert werden. Das zweifelhafte Glück des einzelnen, mit seinen Fundstücken in das Tagesgeschäft der Weltauslegung eingegangen und also untergegangen zu sein, hält dem Unglück die Waage, jene Wege wirklich gegangen zu sein und dabei Ränder gestreift zu haben, von denen die Nachkommenden nichts wissen. Das Unglück ist ein Zwitter, zusammengesetzt aus dem, was sich unter keinen Umständen löst, und dem, was die Verhältnisse mit sich fortnehmen. Zum Glück nehmen sie nicht alles – und nicht auf einmal –, was in den Schriften zu holen ist. Die Geduld des Lesers besteht darin, zu warten, bis sich neue Deutungen einstellen.
Borges ist einer, auf den zu warten sich gehört.