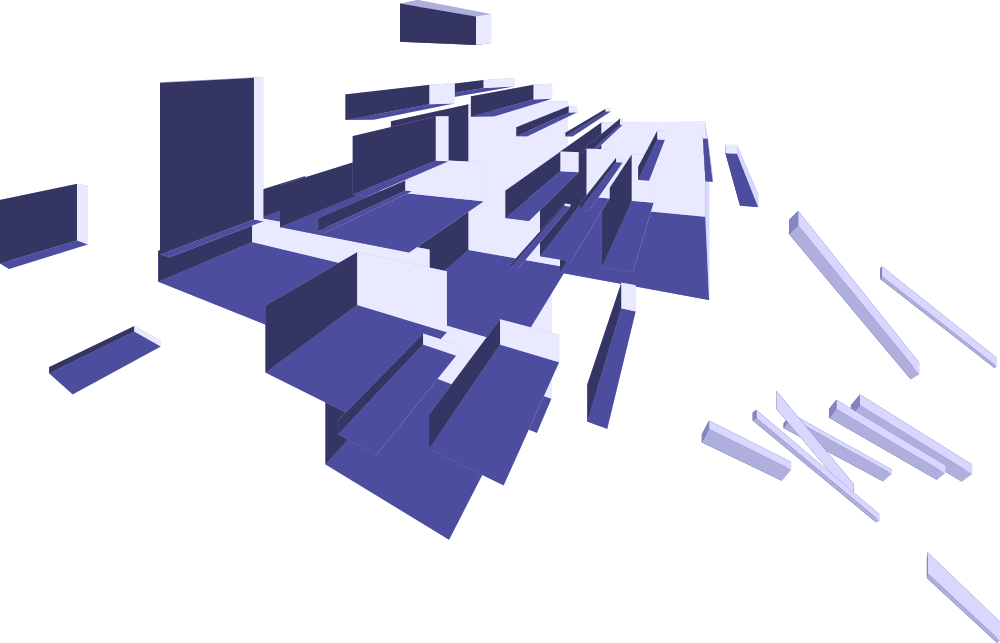1.
Die Geschichte des Dichters Tubutsch, dem der Anblick zweier im Tintenfass ertrunkener Fliegen die Profession verleidet, hat den Gang der Welt weder aufgehalten noch beschleunigt, sie hat nicht verändernd in ihn eingegriffen und auch nicht zur Veränderung aufgerufen. Sie ist jedoch, ebenso wie die ihres Verfassers, in den Weltlauf eingegangen, und die Frage, ob das und was daran wichtig sei, mag zwar grammatisch korrekt sein, aber sie stellt dem Fragenden kein gutes Zeugnis aus. Man könnte sie leicht ›sinnlos‹ nennen, wäre man nicht durch die leichtfertige und korrupte Verwendung der Vokabel gewitzt und abgebrüht in einem, so dass man gern darauf verzichtet. Wo Dichtung ist, muss Welt werden - diese Losung der expressionistischen und auf sie folgenden Jahrzehnte hat zu viele Gehirne getrübt und zu viele Schicksale besiegelt, als dass man ihrer noch in Ehrfurcht gedächte. ›Tubutsch‹ ist die Figur des unwichtigen Dichters, so wie sein ungleicher Bruder im Geiste, ›Ubu Roi‹, die Figur des unwichtigen Herrschers. Beide sind – ›seither‹, wie man sagt – ›in der Welt‹ und auf keine Weise aus ihr zu entfernen. Das haben ihre Verfasser auf sehr unterschiedliche Weise erfahren.
›Seither‹ ist eine merkwürdige Vokabel, eine Tubutsch-Vokabel, die daran erinnert, dass es keineswegs nötig ist, einen ›Umstand‹ immer aufs Neue zu erwähnen. »Ich jedoch muss, wenn es mir zu fad wird, ›Ich‹ zu sein, notgedrungen ein anderer werden.« Das Leben des Herrn Tubutsch besteht aus einer Folge von Glücksmomenten, denen das ›Glück‹ abhanden gekommen ist. Der mimetische Drang, der in Lebensläufen wirksam wird, hat in den mimetischen Exerzitien, in denen Tubutsch ›ein anderer‹ ist, frei. »Gewöhnlich bin ich Marius und sitz auf den Ruinen von Karthago; manchmal aber bin ich der Fürst Echsenklumm, unterhalte Beziehungen zu einer Opernsängerin...« Der andere dieser Spiele ist angekommen, er ist auch einer, gerade dadurch erregt er den Ehrgeiz des Stiefelknechts, der auch einer sein will. Das sind durchsichtige Spiele, sie laden ein, auf den Grund zu sehen, den Wunsch, sich zu unterscheiden. Tubutsch sieht hier klar: Es ist der Wunsch, der die Unterschiede vernichtet, er ist der große Gleichmacher, das sich selbst mitnehmende Begehren, das im Begehren der anderen nur den Widerstand erkennt, den die Wirklichkeit der Erfüllung des eigenen Wunsches entgegensetzt. »So träumt ich vom Ruhm. Er wurde mir nicht zugestellt. Und was blieb, waren Sarkasmen gegen die Glücklicheren.«
Die Welt ist dicht, sie wartet nicht auf den Einsatz dessen, der sich ›zu Wort meldet‹. Glücklicher ist, wer sich im Neid spiegelt. Darin liegt eine perspektivische Vertauschung. Der Neid erschafft den Glücklicheren, der immer ein anderer ist, weil er auch ist, weil er ist. Das darf nicht sein, und daher kehrt sich die Denkfigur um. Er ist auch keiner, er ist nicht, darin liegt das Erkennen. Der General vor den Auslagen in Mariahilf, die Dohle mit den gebrochenen Flügeln vor dem Blumengeschäft in der Weihburggasse, der Wirt Dominik, der »an seinem Ehrentag sich entfernt, um bei einem andern Wirt, also sozusagen bei sich, zu zechen«, die zwei Fliegen Pollak sind Bilder des immergleichen Danach, dessen Davor das Leben auf etwas hin wäre, der Karrierepfad für Erstersteiger, denen der kleinste Berg genügt, die kleinste Erhebung: »Beschränkt sind die Möglichkeiten, immer aber die großen Worte. Eine Diskrepanz für viele.«
Das Ich wird das Es nicht los, die Welt nicht die Dichter. Die großen Worte sind Sache der Dichter, der mit Ruhmsucht Geschlagenen. Sie sind aber nicht ihre Sache, sie schlagen bei ihnen nur an. Die Diskrepanz macht den Unterschied, von Anfang an. Kein Ruhm ohne Rühmer, kein Rühmer, der sich nicht seinen Anteil am Ruhm holen wollte. ›Homer‹ wurde die Summe derer, die er Helden nennt. Manche gehen den Weg der Erpressung, die meisten in die Irre. Der ›Irrsinn‹, an dem sich die Expressionisten abarbeiten, hat hier eine nicht unverächtliche Wurzel. Die Verachtung der ›Tagesprominenz‹ verdankt sich dem Neid auf die Journalisten, die Pindar nicht kennen, aber schneller sind. Es ist aber kein einfacher Neid, in ihm brodeln der Zorn auf die Leichtigkeit des Andersseins bei den anderen und die Verzweiflung über die Fadheit des ›Ich‹, dem es am Wesentlichen mangelt: an Beachtung. »Wenn ich morgen den mir unbekannten Weinpanscher und Mimen zur Rechenschaft ziehen werde für längst vergessene Sachen, so tu ich das aus so was wie Solidarität, kurz, es handelt sich hier um rein prinzipielle Dinge...« Die ›längst vergessenen Sachen‹ sind Momente der Nichtbeachtung, die als Akte der Nichtachtung in den seelischen Haushalt dessen eingehen, der seinem Bei-sich-selbst-Sein den öffentlichen Zuspruch erzwingen möchte. Da darf die Selbstmord-Drohung nicht fehlen. Sie muss komisch sein, da sie die Unabhängigkeit des Gemüts zeigen muss, sie muss gefährlich klingen, weil ihre Ungeheuerlichkeit sonst nicht sichtbar würde, und sie muss lächerlich wirken, weil sie auf eine Handlungsebene verweist, die eo ipso lächerlich ist. »Ich glaub, ich werd es nicht ertragen, wenn mich auch noch der Tod mit einer Enttäuschung abspeist.«
2.
Eines ist der Ruhm, ein anderes der Lebenslauf. Die gleiche Instanz, die den ersteren verweigert, diktiert den letzteren. Der feste Vorsatz, dem Unentrinnbaren zu entrinnen, reicht bis zum Tintenfass. Eine Schreibfeder ist keine Mordwaffe, aber sie bedeutet den Tod. So enthält die kurze Schrift Tubutsch den Schriftsteller Ehrenstein, sie verfolgt ihn bis in den Tod und darüber hinaus in die Nachrufe und Erinnerungen derer, die ihn ›gekannt‹ haben. Blieb er nicht der Fremde par excellence? War nicht das Schweigen das Asyl dieser Fremdheit seit jeher? Das sind Gedanken über Tubutsch: Gut, dass es ihn gibt. Wer weiß, ob ihn ein anderer so schön erfunden hätte wie dieser junge Mann aus der Wiener Vorstadt, der bereits in Berlin lebt, als sein alter ego im Dezember 1911 ›erscheint‹. Knapp drei Jahre später beginnt der Weltkrieg.
1933 brennen Ehrensteins Bücher. Der Schriftsteller befasst sich mit dem Judenproblem. 1934 trifft man sich zum 1. Unionskongress der Sowjetschriftsteller in Moskau. Ehrenstein bereist Russland. Der Schweiz ist das Schreiben ohne Arbeitserlaubnis suspekt, Ehrenstein erhält eine Polizeistrafe. Europa ist Barbaropa. Die Weltstadt Zürich weist ihn aus. Ehrenstein entdeckt das Mutterrecht. Der Dichter erhält ein Notvisum der Vereinigten Staaten von Amerika, sein Bruder stirbt im KZ. Die Not bleibt, das Asyl auch. Die Grabrede hält Kurt Pinthus. Der Schriftsteller ohne Arbeitserlaubnis, der Dichter in New York, der nicht mehr dichtet, der wortsüchtige Mensch, der in Einsamkeit endet, sie sind schockartige Realisierungen des Tubutsch-Themas durch eine Instanz, die man nicht mit dem Literaten verwechseln sollte, den es dazwischen gibt und dem sinnigerweise der Erfolg dieser Schrift den Weg ebnet. Wohin?