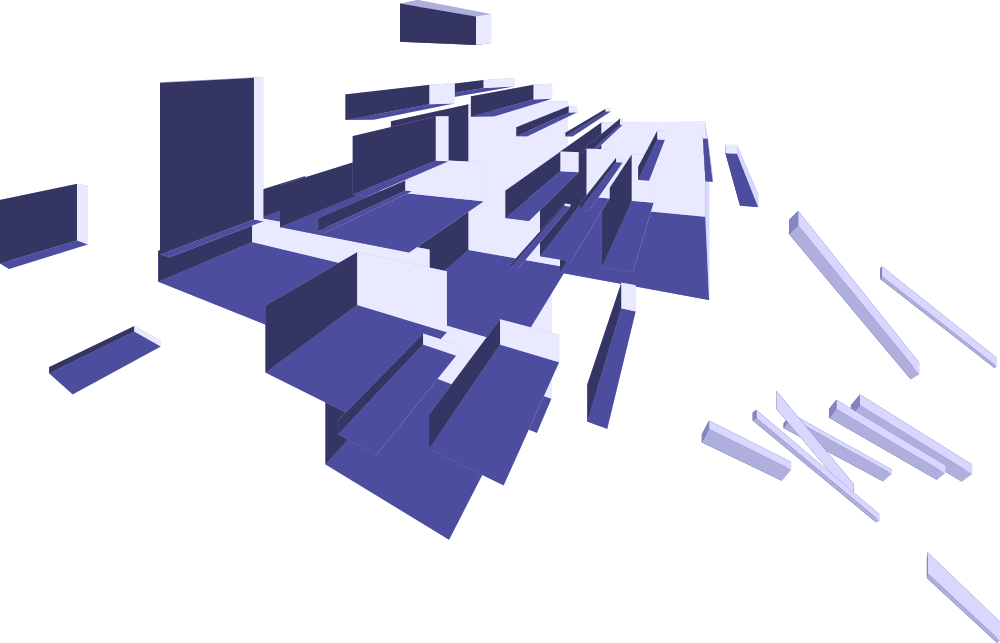1.
Der vorliegende Band1 enthält Zeichnungen von Jürgen Wölbing aus den Jahren 1962-87. Der Zeitraum – 25 Jahre – umfasst die zwei entscheidenden Phasen im bisherigen Schaffen des Künstlers; die Zäsur fällt in die Jahre 1973-74. Der Katalog trägt diesem Sachverhalt Rechnung, insofern er, unter Verzicht auf Chronologie, Arbeiten aus beiden Perioden reihend und kontrastierend gegeneinanderstellt. Deutlich tritt auf diese Weise die Differenz der Verfahrensweisen zutage, ebenso ihre vexierbildhafte Wechselbeziehung. Man vergleiche das sich entgliedernde Portrait von 1967 mit dem konzentrierten Schrei von 1978: der Betrachter kann sich nur schwer dem Eindruck entziehen, dass hier ein analoges zeichnerisches Problem zwei extreme Lösungen gefunden hat, und er sieht sich aufgefordert, eine Sehweise zu praktizieren, die beide in den Blick bekommt, ohne an ihnen abzugleiten. Welches wäre eine solche Sehweise? Mein Vorschlag lautet: die des Lesers – zunächst, weil es eine Handschrift zu entziffern gilt, deren Lesbarkeit zunehmend von Voraussetzungen abhängt, die im Blick auf das vorausgehende Werk erschlossen werden müssen, sodann, weil der Betrachter irgendwann merkt, dass er es bereits mit Lektüren zu tun hat. ln Wölbings Zeichnungen fungiert als zeichnerisches Subjekt das flüchtige Subjekt des Lesens. Was besagt das? Es besagt, dass der Zeichner seine Gegenstände aus dem abschweifenden Blick des Lesenden entstehen lässt, während seine Konzentration sich mit den lnhalten der Lektüre verschränkt. Die erblätterte Welt ist die zerlesene, das Resultat einer doppelten Wahrnehmung. Die Zeichnung entsteht, cum grano salis, aus der Textur der Zerlesenheit, aus Rissen und Sprüngen, die von den Rändern her die Fläche erobern. In der frühen Phase wird dieses Verfahren beinahe naturalistisch gehandhabt. Kurze Linien wechseln mit extrem langen, die sich zitternd und zerrinnend über das Blatt ziehen, annähernd parallel, dann wieder abrupt die Richtung wechselnd, so dass die Figur wie die Kehrseite der materialen Textur erscheint.
Anders liegen die Dinge in der zweiten Phase. Das neu gewonnene Verfahren duldet keine leeren Flächen; es erlaubt Wirkungen, die zugleich plastisch und abstrakt sind, indem es den kalkulierten Zufall ins Spiel bringt: fast monochrome Geflechte aus winzigen Strichen von wechselnder Dichte, die der Intention des Zeichners zu entzucken scheinen, statt ihr zu folgen, organisieren den Bildraum, konzentrisch auch sie: nicht der leeren Mitte, sondern der – scheinbar – verfehlten gilt das Augenmerk; ein Zufallswurf führt die Bewegung ins Ziel. Wenn es im ersten Fall die ausgesparte Mitte ist, so im zweiten die abstrakte Mitte, in der die Intention ertrinkt. Das muss keineswegs der traditionelle Bildmittelpunkt sein. Weit bezeichnender für die neue Technik ist, dass sie dezentrale Zentren schafft und miteinander vernetzt: die Kunst folgt darin dem Wissen, ob bewusstlos oder bewusst, tut nichts zur Sache.
2.
Jede Annäherung des Zeichners an gegenständliche Wirkungen erzeugt räumliche Illusion. Das ist nichtzu vermeiden, doch eben darum nicht unproblematisch, sobald die Kunst sich dem Diktat des natürlichen Sehens entzieht. Es ist ohne Zweifel eine der kardinalen Fragen der modernen Malerei, wie sie räumliche Tiefenwirkungen konstruiert. Soweit ich sehe, verfügt Wölbing über mindestens zwei Konzeptionen, die sich gelegentlich im Resultat überlagern, wenngleich der Unterschied zwischen ihnen ins Auge springt. Die eine besteht darin, der ersten – unwillkürlichen – Illusion eine zweite – willkürliche – einzuziehen, die von Schicht und Distanz. Das heißt, die Zeichenebene erscheint als Projektionsebene von optischen Reizen, die in der imaginären Zeichenwelt auf verschiedenen, in der Tiefe gestaffelten Ebenen lokalisiert sind. Auf diese Weise nötigt das Bild den Betrachter zum zweiten Blick. Der erste gilt dem imaginären Objekt, der zweite der Machart, doch das Bild narrt den zweiten wie den ersten, insofern es ihm eine neue, wiederum imaginäre Objektebene offeriert. Blätter wie Tierfreunde oder, fast noch eingängiger, Breitwand zeigen die frühe Variante: auf ihnen werden, gleichsam realistisch, zwei Raumillusionen so gegeneinander geführt, dass der Betrachter abwechselnd in der einen oder in der anderen verharrt. Und wieder muss die frühe Lösung in der späteren, mit dem Perspektivismus kokettierenden Variante mitgesehen werden. Der Nebelaufgang von 1987 bietet dafür ein prägnantes Beispiel: bei genauem Hinsehen entdeckt man, dass die perspektivisch gesehene Landschaft eine zweite Tiefenwirkung optisch verstellt, die sich an ungegenständlichen Schichten von unterschiedlicher Struktur und Farbigkeit realisiert. Beide Raumwirkungen sind so ausbalanciert, dass die Wahrnehmung des Betrachters ständig wechselt, ohne dass ihm die Gründe dafür notwendig deutlich werden. – Ganz anders hingegen der Eindruck, den die konvexen Welten des Zeichners hinterlassen – Objektwelten, die sich dem Betrachter entgegenwölben und wieder in sich zurücklaufen. Hier ist der Kunstgriff für jedermann sichtbar, doch sind die Resultate deshalb nicht weniger rätselhaft. In dieser Raumkonzeption greifen nicht zwei Illusionen ineinander, sondern die Illusion der einen Welt – einschließlich von Objekt und Betrachter – wird durch die einer fremden Welt ersetzt – einer Welt, die der Betrachter gleichsam auf dem Finger balanciert, nur um zu erfahren, dass es ihm unmöglich ist, in sie einzudringen. Das ist der Preis, den er dafür zahlt, dass er einer anderen Welt ansichtig wird; träte er in sie ein, so wäre es schon die seine. Doch natürlich ist jene Welt, wie sollte es anders sein, ein Symbol für die Welt der Fiktionen, aus denen kein Entrinnen möglich ist. So jedenfalls meint es der Titel von 1973 (Fiktion): inmitten eines reflektierenden Globus blickt den Betrachtenden ein lidloses Auge an – das Auge des Betrachters, der in sich den anderen erkennt.
3.
Es gibt Antworten, die Ritualen gleichkommen. So die Auskunft des Malers auf die Frage nach dem Sinn seines Tuns, ihn interessiere z.B. die Wirkung eines bestimmten Gelb, gegen dieses oder jenes Blau gestellt. Mit ihr gibt er seine Zugehörigkeit zur Moderne zu Protokoll: die Fragen der Kunst sind technische Fragen. Doch das ist, auf den Zeichner Wölbing gemünzt, allenfalls die halbe Wahrheit. Seine Arbeiten entstammen nicht nur der Moderne, sie reflektieren auf sie. Die Art und Weise, in der das geschieht, macht hellhörig. Zwei Phasen der Produktion, zweierlei Zeitgenossenschaft: die erste, bis Mitte der siebziger Jahre, ist die der Aneignung des damaligen Zeitstils, eine höchst individuelle Aneignung, doch eine, die auf das Ensemble der vorhandenen Möglichkeiten zielt. Die zweite reflektiert das Angeeignete im Spiegel von Auffassungen, die der Moderne vorausliegen, mit wachsendem Radius: von der Malerei der deutschen Romantik über die niederländische Malerei bis hin zur italienischen Spätrenaissance und zum China der Ch’ing-Zeit. Mit dem Rückgriff auf archaische und manieristische Kunstformen in den frühen Jahrzehnten dieses Jahrhunderts hat das wenig zu schaffen. Damals ging es darum, den Kanon der Moderne zu erfinden; Wölbing weiß, dass heute die Frage lautet, warum die Moderne sich nicht genügt. Nicht, als ob er die Antwort wüsste; aber er offeriert ein Verfahren; nichts könnte mehr überzeugen. Das lebensweltliche Motiv hält der physiognomischen Erkundung fremder Zeichen-Welten die Waage. Alles ist gesehen – auf Distanz. Ausdrucksminderung als ästhetische Pointe, Minimierung der Intentionen, auf denen die Vorlagen beruhen – man könnte meinen, es sei die unbestimmte Angst vor der Leere, die den Künstler veranlasst, Blatt um Blatt mit all den Figuren zu bedecken, an denen wir sehen lernten, eine Angst, die der Leere zuspielt, was ihr gehört. Das ist eine Lesart. Die andere wird kenntlich, wenn diese Kultur Fassaden freilegt, um sie zu versiegeln: begehbar machen, was dem Sinn entgeht.