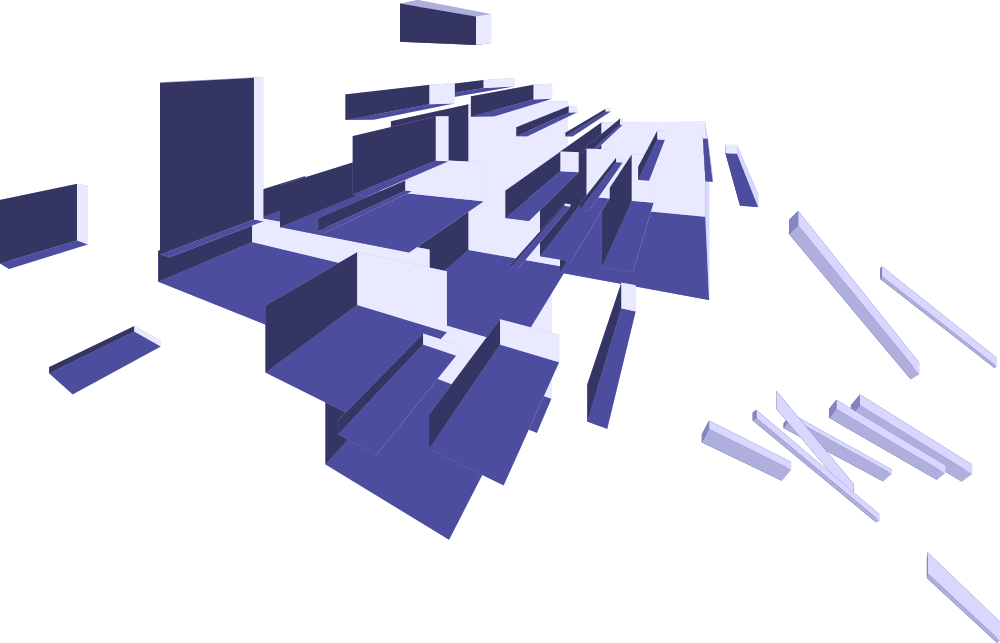1.
Geschrieben hat Paul Mersmann schon immer: nicht wie einer, der neben der Malerei auch schriftstellert, sondern wie ein Maler, dessen Kunst überall zum Wort drängt, teils, um all die Bilder einer strömenden Phantasie festzuhalten, der keine Leinwand und kein Zeichenblatt gewachsen wäre, teils, weil in den Bilder selbst die Tendenz zum Wort, zur sprachlichen Figur angelegt ist. Mersmanns Bilderwelt erzählt keine Geschichten, sie macht Geschichten: soll heißen, der rote Faden, den sich so mancher Betrachter wünscht, liegt in ihnen nicht offen aus, sondern verlangt nach einem blitzartig die Perspektive, den Tonfall und die Betrachtungsart wechselnden Erzähler, der das Erstaunen angesichts des Gesehenen nicht aufhebt, sondern listig steigert, bis er es mit einem plötzlichen Lächeln quittiert.
2.
Mersmanns Erzählungen gehören zu jenem Zweig der phantastischen Literatur, der des schlichten Reise-Genres nicht – oder nicht wirklich – bedarf, weil im Kopf des Autors genügend Material bereit liegt, um das Fassungsvermögen des durchschnittlichen Lesers in alle möglichen Richtungen zu strapazieren. Er selbst nennt Franz Kafka und Jorge Luis Borges, gelegentlich auch Giorgio Manganelli, wenn es gilt, empfundene Verwandtschaften zu bezeichnen. Doch die Bildhaftigkeit seines Erzählens geht über solche Modelle weit hinaus. Eher lässt sie an die surrealistischen Filmmontagen Luis Bunũels und an manche Passagen aus Georges Batailles Geschichte des Auges denken.
3.
Ironischerweise lehnt Mersmann den Film, ebenso wie die Fotografie, als künstlerisches Medium ab. Die Aufnahmetechnik als Substitution der schreibenden, zeichnenden, malenden Hand ist ihm zuwider. Er sieht in ihrem Gebrauch die Sünde wider den schamanischen Geist und die Intimität des schöpferischen Vorgangs. Dass er mit dieser Deutung sich ganz im Bannkreis des Surrealismus und der Subjekt-Studien Batailles bewegt, ist ihm genauso bewusst wie der Widerspruch, der darin liegt. Dem Surrealismus war und ist jedes Mittel recht. Mersmann hingegen dient das rechte Mittel nicht als Mittel zum Zweck, sondern als Zweck-Mittel oder Mittel-Zweck, eine zwischen die fixen Welt-Instanzen eingeschobene unreine Zone, in der die Welt als Purgatorium aufscheint. Der Widerspruch wirkt darin als ein Kuriosum, das immer wieder hervorgekitzelt werden muss. Er entsteht durch die ›Verlängerung‹ des Begriffs ins Absurde: »Es sagte mir jemand, die Verlängerung des Begriffs Ödnis würde unweigerlich ins Meer führen.« (Ödnis) Wer so redet, ist schon verloren – oder ein Künstler, dem die Rede im Bild aufgeht. Der Logizismus zerstört, wie das Quadrat in der Malerei, das Denken an der Stelle, an der es entsteht: blitzartig, in grotesker Sinn-Einheit mit dem Bild, das schon im Deutlicherwerden dem nächsten weicht, analog zum Gedanken, der im Denkvorgang selbst ein uneinholbar anderer wird: »Etwas von Kants ›Ding an sich‹ überzog ein bei W. im Korridor gesehenes Dienstmädchen, das in der Schwärze einer bereits unendlich lange vergangenen Gesellschaft halbmechanischer Menschen auf kleinen Rädern an mir vorüber rollte.« (Die Einladung eines Mondes)
4.
Dass die Nacht in dieser Bewusstseins-Kunst eine hervorgehobene Bedeutung besitzt, versteht sich fast von selbst. Die Wörter-Reisen durch ein Bewusstsein, das, seiner Tagesfunktionen ledig, sich in freier Kombinatorik übt, sind ja keine Eins-zu-eins-Wiedergaben traumbefangenen Denkens, sondern erfordern eine scharfe Detail-Auswahl. Der Traum selbst besitzt keine Sprache – ein Umstand, der dem Erzähler eine seiner verrückteren Pointen liefert. »Übrigens hörte und sah ich die meisten dieser Dinge … ganz flach und ohne ein sprachliches Relief in Tönen, mehr im Sinne eines gemalten Nebels in unterschiedlichen Farben der Lesbarkeit, die mit den Bildern alltäglichen Denkens in keinem Zusammenhang stand«, heißt es in Belehrungen. Die Pointe besteht darin, dass der von Worten umspielte Traum-Sinn den Widerspruch zum Wach- oder Tag-Sinn gleich in sich mit enthält. Dem Schreiben scheint nichts anderes aufgetragen, als ihn auszuwickeln. Wenn es also einer Übersetzung bedarf, dann nicht aus der Sprache des Traums in die des Wachseins, sondern einer der immer wachen Sprache in traumhaft wirkende Sequenzen hinein, die im Leser etwas hervorbringen, das entfernt an die Turbulenzen des Traums erinnert.
5.
Als Maler, Zeichner, Illustrator, Bildhauer und Literat hat Paul Mersmann, Jahrgang 1929, ein beachtliches Œuvre geschaffen, das in vieler Hinsicht noch der Erschließung harrt. Die ersten bedeutenden Arbeiten stammen aus den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts, einen Höhepunkt markieren die in den Achtzigern ausgeführten Wandmalereien in Privathäusern und an öffentlichen Orten, vor allem im Wiesbadener Raum. Damals entstanden auch die ›Keltischen Gottheiten‹ Rosmerta, Sirona, Epona: drei Großplastiken, die heute in einem Dresdner Hotel zu bewundern sind, sowie, für die Folgeentwicklung vielleicht bedeutender, die ersten A.B.C.-Bücher, deren Reihe Mersmann über die Jahrtausendwende hinweg fortführte. Schon die Keltischen Gottheiten erhalten literarische Begleitung, die A.B.C.-Bücher nehmen Text und Kommentar in die einzelnen Blätter hinein. Nach älteren Romanversuchen scheint hier das Prinzip gefunden, das in den Illustrationen zur Genesis, zum Exodus, zum Buch Ruth und schließlich zur Apokalypse des Johannes seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellt. Nicht unerwähnt bleibe das Alphazet, unser beider Gemeinschaftswerk, von Mersmann prachtvoll bebildert und mit einer Fülle tiefsinnig spielerischer Texte angereichert. Manche der hier vorliegenden Erzählungen wirken, als seien sie dem Milieu der »etceterarischen Grundbegriffe« soeben entwachsen und hafteten noch hier und da an ihm fest.
6.
Am besten charakterisiert den Erzähler Mersmann vielleicht die Geschichte vom Teemeister aus Laura Solbachs filmischem Kurzporträt Die irrealen Tiere aus dem Jahre 2010: hier spricht sich eine unruhige und zugleich gelassene Sorge um die Kunst, ihr selbstverständlich-fragiles Verwobensein mit der Lebenskunst und ihr tiefes Im-Bunde-Stehen mit der Gebrechlichkeit der Welt aus, die für den genauen Leser allenthalben sichtbar sind. Es ist nur halb im Scherz, dass sich der greise Künstler als ›Gnostiker‹ von Lichtel tituliert: wissen, ohne zu wissen, verstanden zu haben, ohne dem Verstehen zu opfern, die Kausalität und Nichtigkeit des Geschehens tief empfunden zu haben und im Plauderton den Zug des unumgänglichen Unglücks in die Annalen der Besserwisserei einzuzeichnen – darin besteht, mit einer Wendung aus den »Kaleidoskopischen Schriften« – »ja nur der Anfang, die kleine Vorschau auf den Orkan der Verwandlungen, der seine Sendboten jetzt noch sehr friedlich unter die Büsche eines Abhangs oder in die Spalten einer Felswand gelegt hat... Denn den wahren, den furchtbaren, wahrhaftig ganz unpoetischen Takt, den schlagen noch einmal ganz andere, noch viel fernere Wesen.«