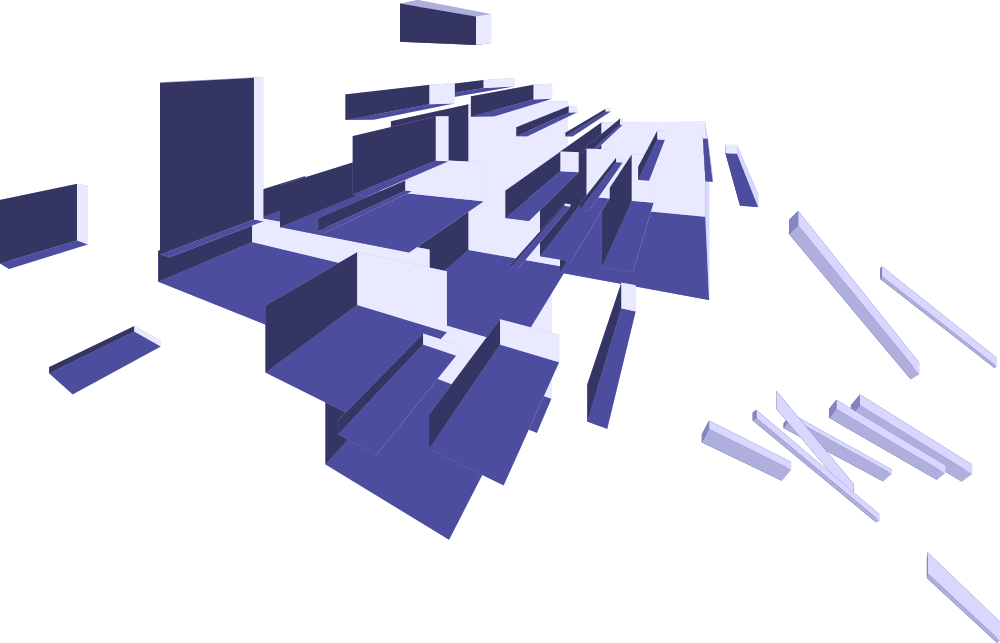Das Problem besteht darin, dass jede Flaschengeneration die Erfahrungen der vorhergehenden wiederholen muss. Da höre ich schon Gewisper: Wie kann das sein? Wovon redet der Mann? Nun, es hat mit ihrer Herstellung zu tun. Wir, die Community der Flaschenbenutzer, verstehen intuitiv, wie viel sinnvoller es doch ist, identische Flaschen in Massenproduktion herzustellen, statt jede einzelne liebevoll als Individuum auszubilden. Eine der ersten Regeln des Universums lautet: Einfachheit macht Sinn. Daher tritt das Einfache häufiger auf – es hat einfach mehr zu bieten. So ist es nur eine Frage der Zeit, dass sich die Massenproduktion in den Vordergrund schiebt und fast den gesamten Horizont füllt. Masse will Masse.
In diesem, dem Flaschen-Fall, will das nicht viel bedeuten. Gerade der Flaschenhorizont gilt seit altersher als beschränkt. Das mag ein Vorurteil sein, aber Vorurteile besitzen nun mal ein zähes Leben, vor allem dann, wenn Erfahrung sie tränkt. Flasche und Vorurteil gehören gewissermaßen zusammen. Sie ergänzen einander und sind, wie es sich für richtige Partner gehört, stets füreinander da. Ich kenne Flaschen, so vollgestopft mit Vorurteilen, dass man sie auf kein Holzregal zu stellen wagt, aus Furcht, es bräche über kurz oder lang unter ihrem Gewicht auseinander. Damit ist bereits ein wichtiger Punkt angesprochen: die Furcht vor der Flasche. Niemand kann mit Gewissheit sagen, was sich in einer Flasche befindet, solange sie nicht geleert ist. Nüchtern ausgedrückt: Nur die leere Flasche genießt unser Vertrauen. Anders steht es um die Achtung, darauf komme ich noch. Aber nicht hier liegt das Problem.
Die Schwierigkeit liegt in der Lagerung. Flaschen sind, wie jeder weiß, Lagerware. Sie lieben dunkle Keller, gleichgültig, ob feucht oder trocken. Im Prinzip könnte man sie auch in Hochhäusern stapeln, in Lagertürmen, selbst Flugzeuge, vollbesetzt mit Flaschen, könnte man um den Planeten kreisen lassen, in der Luft betankt und kaum je eine Landebahn berührend, es sei denn zu einer Flaschenkonferenz oder dergleichen. Technisch wäre das kein Problem. Doch wie auch immer, es geschieht einfach nicht. Die Flasche schätzt es nicht, wenn man ihr solche Vorschläge unterbreitet. Die Flasche, gleichgültig ob rot, braun, grün oder ungefärbt, liebt die Kellerlage und ihr Wunsch ist den Kellermeistern dieser Welt Befehl. In Milliarden von Kellern, tief unter der Erde ihr Schicksal bedenkend, reift die Flasche ihrem Ende entgegen. Dieses Ende, wir kommen gleich darauf, befindet sich in den Händen einer Spezies, die sich selbst gern die räuberische nennt, weil sie vor keinem Geheimnis der Natur zurückschreckt –: Sie kennen sie, wir alle sind ein Teil von ihr, wir halten das Schicksal der Welt in Händen und spüren nichts als eine Flasche.
Wie billig, denken Sie jetzt: die Flasche als Metapher. Will der Kerl uns veralbern? Wie platt ist das denn? Wie durchsichtig! Wie geistlos! Das hätten Sie nicht erwartet. Von mir nicht und nicht von diesem Frühlingsmorgen, an dem Sie beschlossen haben, Ihre vom letzten Shutdown her zugemüllte Wohnung für eine Stunde zu verlassen, teils, um die notwendigen Einkäufe zu tätigen, teils, um die Beobachter zu beobachten, die neuerdings mit entsichertem Smartphone durch Ihr Viertel streifen, um Kontaktpersonen datenkundig zu machen. Nichts befriedigt die menschliche Seele mehr als die Beobachtung der Beobachter, vor allem, wenn es sich um solche zweiten und dritten Grades handelt, die sich allerdings seltener auf der Straße herumtreiben, da sie gehalten sind, das Ganze im Blick zu behalten. Das Ganze im Blick: hätten Sie’s nicht auch gern? Ich für meine Person spüre eine leidenschaftliche Bewegung, wann immer ich an das Ganze denke. Es ist eben, was immer man von ihm halten mag, das Ganze und damit, anders als jeder einzelne von uns, unhintergehbar.
Sie täuschen sich, wenn Sie denken, Sie hätten mich durchschaut. Nicht ich bin die Flasche, ich drehe sie nur hin und her. Auch Flaschen verfügen über eine Vorder- und eine Rückseite, ein Umstand, den sich die Etikettenaufkleber dieser Welt seit jeher zunutze machen. Sie merken, ich rede über die Flasche an sich und keineswegs über eine blutleere Metapher. Die Flasche an sich besitzt, neben Vorder- und Rückseite, eine Perspektive – eine großartige, behaupten viele, wieder andere wiegen das Haupt und behaupten: keine. Es sind nicht die Flaschenhäuptlinge, die solche Gespräche führen, sie liegen ruhig in ihren Halterungen und warten ab. Unruhe erfüllt nur die unteren Chargen, zwischen denen das Gespräch nicht erstirbt – sie denken nach. Wirklich, es gibt Flaschen, randvoll gefüllt mit Unruhe, und niemand nimmt sie ihnen ab. Auch Flaschen haben lichte Momente. Gleich daneben stapeln sich die Ausfälle.
Hören Sie zu, Sie können noch etwas lernen. Die Flasche, wie wir sie kennen, ist das Produkt einer langen, erfolgreichen Evolution. Leider hat die einzelne Flasche zu ihr nichts beigetragen und nie wird sie zu ihr etwas beitragen. Evolution und Flasche sind so sicher voneinander getrennt wie Regierung und Opposition. Die Evolution bestimmt die Richtung und die Opposition … opponiert, sollte man annehmen, doch im Flaschenuniversum liegen die Dinge anders. Man zeige mir eine Flasche, die opponiert, und ich fahre die Welt auf einer Sackkarre davon. Die Flasche, einzeln oder in Batterien, ist bloß das gerade Gegenteil der Evolution, sie ist frei in ihren Entschlüssen und niemandem Rechenschaft schuldig. Dabei ist jede, genau betrachtet, das Ergebnis einer Wahl. Sie alle wurden gezogen, um gewählt zu werden, nicht ihrer exquisiten Individualität wegen, sondern weil sie den Erwartungen entsprechen, die man an eine Flasche stellt. Die zweite Wahl, die sie aus dem Regal an Licht holt, ist eigentlich nur ein Widerschein, ein entfernter Abglanz der Design-Entscheidung, die ihrer Entstehung zugrunde liegt.
Man sollte also meinen, es liege in der Verantwortung jeder Flasche, sich der Aufgabe gewachsen zu zeigen, für die sie – ihre Größe, Form, Wandstärke, Glasqualität – gewählt wurde. Da lacht der Technokrat, er lacht über beide Ohren, die ganz heiß anlaufen, er lacht sein Sonntagslachen, denn während der Woche gibt’s nichts zu lachen, da wird gearbeitet.
Gewissen Flaschen, Sie wissen es, erteilt man den Flaschensegen. Ihr Inhalt soll sich segensreich über die Welt ergießen, jedenfalls über gewisse Teile davon, Macher sprechen in diesem Zusammenhang von Arznei. Andere verwendet man zu Schiffstaufen oder Ähnlichem und zerschmettert sie zu diesem Zweck an Bordwänden. Wieder andere werden geköpft. Die geköpfte Flasche ist schon ein Sinnbild: Sie demonstriert aller Welt, dass es möglich ist, direkt, unter Weglassung des Kopfes, sich der Vorräte dieser Welt zu bemächtigen, aber auch, dass man schnell geschnitten ist, lässt man sich erst darauf ein. Ich kannte eine geübte Flaschenköpferin, die pingelig jeden erköpften Flascheninhalt in den Ausguss entleerte – ein durchsichtiges, aber effektives Überlebenskonzept in Zeiten, in denen es nicht auf Inhalte ankommt und das Konzept ›Flasche‹ ohnehin auf der Abschussliste der Ideolog*innen steht. Wie dem auch sei, Flaschen dienen seit Anbeginn der Welt einem teuflischen Zweck. Sie verbreiten den Alkoholismus, diese Menschheitspest, über alle Klimate und Klassenschranken hinweg und richten damit genau all die Schäden an, die man ihnen aufs Konto schreibt.
Sehen Sie gelegentlich Western? Dann kennen Sie die Szene, in der sich der Held auf seine blutige Karriere vorbereitet, indem er in Windeseile eine aufgereihte Batterie Flaschen zerschießt. Warum Flaschen? Warum gerade Flaschen? Was unterscheidet diese Erwählten des Schicksals von ordinären Blechbüchsen oder simplen Zielscheiben? Ganz einfach: Sie ergeben ein fast menschliches Ziel, sie zeigen die menschliche Silhouette in ihrer stilisiertesten Form und – sie zerspringen, wie sonst nur das getroffene Herz zerspringt, jedenfalls idealiter, denn in der Realität stellen sich dem einige natürliche und unnatürliche Schwierigkeiten entgegen. Sie zerspringen, so kann man es sagen, gerade weil sie kein Herz haben, jedenfalls kein menschliches. Von Flaschenherzen ist viel die Rede, es wurde nur nie eins gesichtet. Jeder Schuss ein Treffer: wo eben noch die Flasche stand, klafft jetzt die Lücke, die keiner sieht, weil niemand die Flasche vermisst, geschweige denn sich an sie erinnert. »Eine Flasche? Welche Flasche? Wovon reden Sie? Hören Sie, Sie sehen Gespenster, Sie sollten sich untersuchen lassen.« Eine abgeräumte Batterie Flaschen hinterlässt kein Gefühl der Leere, allenfalls eine dumpfe Befriedigung, untermischt mit Staunen darüber, dass alles so einfach vonstatten ging.
Das Problem, das diese im Nu – und ins Nichts – zerspringenden Flaschen dem Verstand bieten, ist das Problem des Nachschubs: Wo zum Teufel kommen in der Einöde all die Flaschen her, die es braucht, um einen Helden großzuziehen? Der Zuschauer weiß es nicht und wird es niemals ergründen. Will er es denn? Nein, er will es nicht. Nichts erlaubt so tiefe Einblicke in die Seele des Zuschauers wie seine völlige Gleichgültigkeit gegenüber der Herkunft der Flaschen, die so ein hochwertiges Leinwandprodukt verbraucht. Wie gesagt, sie steigen aus dunklen Kellern ans Licht, Myriaden von Flaschen, und werden wieder an dunkle Orte verbracht, sofern sie Glück haben und ihnen während ihrer lichten Momente nichts Schlimmes widerfährt. In diesem Zusammenhang hat sich das Stichwort ›Privacy‹ eingebürgert. Man versteht darunter das Recht auf Absonderung, eigentlich Abgesondertheit, einen Zustand, der niemanden etwas angeht, es sei denn, die Kellermeister gehen herum und kontrollieren, selbstverständlich anonym, die Bestände. Im Shutdown zum Beispiel spielt jeder ein wenig Flasche, das kräftigt unser Verständnis für deren schwierige Existenz ungemein.
Hat man einmal begriffen, dass all diese Flaschen, gleich ob lang, gerade, schmal, bauchig, breit, flach oder mit Wespentaille, platzen und und ihrer Objekt-Identität verlustig gehen müssen, weil sich an ihnen die grausame Lust des Zuschauers stillt, das menschliche Herz bluten und zerspringen zu sehen, dann erst versteht man das ungeheure Menschheitsproblem, das sich in ihnen manifestiert: das Problem des Anderen, an dem der Einzelne sich abarbeitet und das er nicht anders lösen kann als dadurch, dass er sich Stellvertreter erschafft, um sie zu ermorden – … ermorden sage ich, denn nichts anderes vollzieht sich im Splitterhagel der Tat, die sich als bloße Übung maskiert. Ist die Flasche also letztlich bloß ein Stellvertreter des Menschen? Ich habe diese Frage Staatsrechtlern vorgelegt und sie haben sie verneint. Der Mensch, erklären sie, bedarf keiner Stellvertretung. Ein Bürger muss sich vertreten lassen, weil er nicht überall anwesend sein kann, aber überall gefragt ist: schließlich ruht das Schicksal des Staates in seinen Händen und darauf kommt es im Staate an. Der Mensch hingegen ist immer gerade da gefragt, wo er sich aufhält. Eigentlich fragt niemand nach ihm, dieser fraglichen Person. Er hält jeden auf, aber in erster Linie sich. Gesamtgesellschaftlich gilt: Der Mensch ist sein Aufenthalt. Der Mensch ist keine Flasche. Ein italienischer Philosoph, der von Nonnen großgezogen wurde, hat es auf die einfache Formel gebracht: Der Mensch ist das nackte Sein.
Die Formel versteht einer besser, hat er erst festgestellt, wie wenig vom Menschen auf dieser Welt zu sehen ist. Der Mensch sieht seine Werke, aber nicht sich selbst. Du siehst ihn am Werke, aber was du da siehst, befriedigt dich nicht. Befriedigung findest du nur in der Flasche, du magst davon halten, was du willst. Da wiegst es schwer, sie ohne allen Inhalt zu sehen und eine letzte Befriedigung daraus zu ziehen, dass ein anderer sie zerschießt. Kommen Sie mir nicht mit dem Einwand, Flaschen hätten nun einmal keine Seele und bedürften deshalb auch keiner Schonung. Alles Seiende bedarf der Schonung, erst recht eines, das, wenngleich nur entfernt, an den Bürger erinnert, dieses schonungsbedürftigste aller Wesen. Sie zweifeln? Denken Sie nach! Ein Wesen, das seine Rechte – die zugleich Pflichten sind – nur durch Stellvertreter auszuüben vermag, während alle Wirkungen, die guten wie die üblen, direkt auf es zurückfallen, tut gut daran, sich bedeckt zu halten und Deckung zu verlangen. Da nun aber die Flasche als idealer Stellvertreter sich mehr und mehr in den Vordergrund schiebt – denken Sie an den Ausgangspunkt meiner Überlegungen! –, bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich um all die Flaschen dort draußen Sorgen zu machen, die eine entfesselte Kreatur, bloß um in der Geschichte groß dazustehen, eine nach der anderen zu nichts zerschießt. Schließlich befindet sich immer auch die eine oder andere von den seinen darunter. Und was heißt dabei schon Geschichte? Ein Leinwand-Spektakel, ein digitaler Hokuspokus, ein Nichts, rascher vergessen als die lange Reihe seiner Vorgänger. Nur der Ärger verwahrt einige Brocken davon und will nicht von ihnen lassen.
Das ist der eine, der bürgerliche Aspekt des Flaschensterbens. Aber es gibt auch andere. Jede geköpfte Flasche ist ein nicht angetretener, ein verschobener Tod, ein Tod auf dem Rücken der als unbelebt konstruierten Natur. Was, so könnte man fragen, ist die einzelne Flasche anderes als ein in menschliche Dienste gepresstes Stück dieses Planeten, dazu bestimmt, Bilder des unausweichlichen Abgangs zu produzieren? Der Mensch verschiebt, wie alles, was zu bewältigen er nicht in der Lage ist, auch den Tod in die Bezirke des Unbelebten. Im Unbelebten, so glaubt er, kennt er sich aus: er zieht den Laborkittel über, beugt sich übers Mikroskop und beginnt zu forschen. Vielmehr, er beginnt nicht – das taten vor ihm längst andere –, er forscht weiter, er forscht dies und das, er bohrt in die Tiefe und baut Zyklotrone, er schleppt Teleskope in den erdnahen Raum, er umzingelt den Planeten mit Forschungsstationen, um Ereignisse zu beobachten, dies alles pro forma, pro virtute, denn eigentlich macht er, wie Myriaden anderer Forscher vor, neben und nach ihm, sich an etwas zu schaffen, das andere vor und neben ihm herangeschafft haben, an etwas von etwas also, das träfe es ein bisschen genauer.
Er beobachtet also den Tod. Und da es an ihm wenig zu beobachten gibt, beobachtet er die kurze Phase davor umso genauer. Doch je genauer er diese Phase beobachtet, desto weniger hat er den Tod im Blick. Er entschwebt ihm sozusagen. Unausweichlich kommt so der Moment, in dem der forschende Mensch vor die Kameras tritt und der Welt verkündet: »Es gibt keinen Tod.« Wieso? Ist er gestorben? Hat ihn ein unbekanntes Virus dahingerafft? Nein, so ist es nicht. ›Es gibt keinen Tod‹ bedeutet: Da ist nichts. Sagen wir – sagt der Beobachter –, dieser Organismus, den wir betrachten, als sei er eine Abfolge von Ereignissen in einem Feld, das man als tot bezeichnen könnte (sofern diese Rede einen Sinn ergäbe), lebt: wer oder was sagt uns denn, dass er auf etwas hin lebt, was wir als Tod bezeichnen könnten? Ersichtlich ergibt auch das keinen Sinn. Wenn also Menschen sterben, so handelt es sich ganz offenbar um einen behebbaren Systemfehler. Beratend können wir feststellen: es ist die Aufgabe der Politik, ihn zu beseitigen. Wer sie wahrnimmt, wer den entscheidenden Schritt in die totale Verantwortung wagt, der steckt sie alle in die Tasche.
Sehen Sie: Die Flasche, das ist der des Lebens entkleidete, der Beobachtung im Moment der Zugewandtheit entschlüpfende Tod. Die menschliche Grausamkeit schuf sich die Flasche und die Flasche schuf sich den Helden, bereit, eine Spur der Verwüstung durch die Landschaft seiner Mitmenschen zu ziehen. So sieht sie aus, die Welt des Kinogängers, die auch die unsere ist.
Nehmen Sie sich da nur nicht aus! Und sparen Sie sich Ihr Mitgefühl. Denn diese Grausamkeit, sie ist es gleichzeitig, die jedem dieser toten und so unendlich gleichgültigen Gegenstände eine Seele verleiht, dazu bestimmt, im Moment der Erschaffung zu vergehen. Sie gleicht darin – mit dieser Betrachtung schließe ich den Kreis meiner Überlegungen – der Massenseele, die, nüchtern betrachtet, nichts weiter ist als das flüchtige Produkt der Begegnung zwischen der Angst der Herrschenden und ihrem Popanz, dem Feind, den es, koste es, was es wolle, zu vernichten gilt. Souverän ist, wer über die Verteilung der Kosten gebietet. Wer immer, Gott oder die Evolution, den Menschen schuf – der Mensch erschuf sich als unüberbietbaren Ausdruck seiner Massenseele die Flasche.
Schon höre ich Gähnen: Welch ein blasiertes Gerede! Am Ende wäre also die Flasche, was immer sie in Wirklichkeit sein mag, doch nur eine Projektion des Machtwillens Einzelner und der Angst der Vielen. So kann, wer verstanden zu haben glaubt, in die Irre gehen. Doch da wir nun einmal bei den Sinnsprüchen gelandet sind: Wie viele Flaschen einer verbraucht, um ein Held zu sein, bestimmt die nach oben offene Skala der Angstlust am Weitergehen. Weiter, immer weiter geht, wer das Splittern bereits im Ohr hat, bevor der Schuss fiel.
erschienen als: