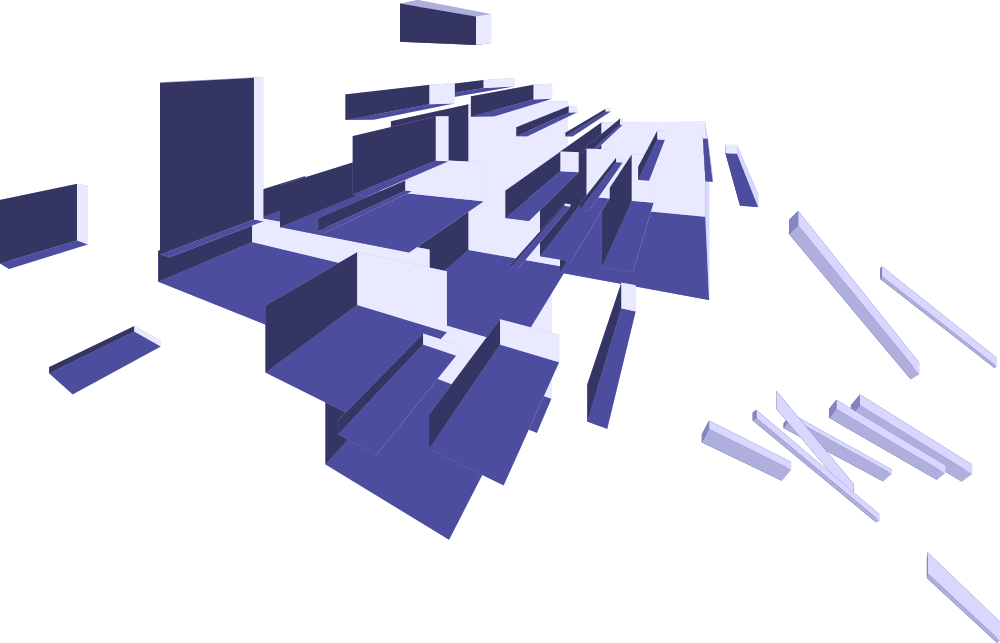Clandestino oder
der Hunger nach Identität
Erzählungen
Manutius Verlag Heidelberg
(Edition Zeno)
416 Seiten
ISBN 978-3-944512-40-2

Die Grenzen der Welt
Essays, Bd. 2
Manutius Verlag Heidelberg
377 Seiten
ISBN 978-3-944512-20-4

Entfesselte Schrift
Essays, Bd. 1
Manutius Verlag Heidelberg
327 Seiten
ISBN 978-3-944512-19-8
Macht ohne Souverän
Die Demontage des Bürgers
im Gesinnungsstaat
Manutius Verlag Heidelberg
383 Seiten
ISBN 978-3-944512-25-9

Hoboken 11
Gedichte
Manutius Verlag Heidelberg
(Edition Zeno)
92 Seiten
ISBN 978-3-944512-37-2

T – Die Stufen des Kapitols
Ein politischer Roman
Manutius Verlag Heidelberg
(Edition Zeno)
376 Seiten
ISBN 978-3-944512-28-0

Das Ende der Kritik
Reprint 2018 Edition (1997)
De Gruyter Akademie Forschung
234 Seiten
ISBN-10 3050031689
ISBN-13 978-3050031682
Das Ungelebte
Studie
Manutius Verlag Heidelberg
(Edition Zeno)
304 Seiten
ISBN 978-3-934877-54-2
Hiero
Tropos
Manutius Verlag Heidelberg
(Edition Zeno)
416 Seiten
ISBN 978-3-934877-75-7
Das Bersten
Erzählung
Manutius Verlag Heidelberg
(Edition Zeno)
267 Seiten
ISBN 978-3-944512-12-9
Deutsches Roulette
Satiren
Manutius Verlag Heidelberg
(Edition Zeno)
63 Seiten
ISBN 978-3-944512-24-2
Das anthropologische
Experiment
Erzählung
Manutius Verlag Heidelberg
(Edition Zeno)
267 Seiten
ISBN 10: 3-934877-45-1
ISBN 13: 978-3-934877-45-0
Entwurf der Lyrik
Studie
Akademie Verlag
326 Seiten
ISBN 3-05-002261-2
Ionas
Gedicht
Manutius Verlag Heidelberg
(Edition Zeno)
66 Seiten
ISBN 10: 3-934877-24-9
ISBN 13: 978-3-934877-24-5
Organum Mortis
Gedichte
Manutius Verlag Heidelberg
(Edition Zeno)
210 Seiten
ISBN 10: 3-934877-24-9
ISBN 13: 978-3-934877-24-5
PoliFem
sat. 1-5
Manutius Verlag Heidelberg
(Edition Zeno)
58 Seiten
ISBN 10: 3-934877-38-9
ISBN 13: 978-3-934877-38-2
Das Land der Frösche
Miniaturen zu Kunst und Literatur
Manutius Verlag Heidelberg
(Edition Zeno)
137 Seiten
ISBN 10: 3-934877-06-0
ISBN 13: 978-3-934877-06-1
Rilkes Engel
Essay
Manutius Verlag Heidelberg
(Sonderausgabe Edition Zeno)
72 Seiten
ISBN 10: 3-934877-13-3
ISBN 13: 978-3-934877-13-9
The Hidden Power
of Nonchalance
Novelle
Manutius Verlag Heidelberg
(Sonderausgabe Edition Zeno)
77 Seiten
ISBN 3-934877-19-2
Uhuru Peak
Ein Bericht
Manutius Verlag Heidelberg
176 Seiten
ISBN 10: 3-925678-97-2
ISBN 13: 978-3-925678-97-4
Gegen Denken steht nur
Gewalt
von Denk-Maschinen und
Bewußtseins-Welten
Manutius Verlag Heidelberg
80 Seiten
ISBN 10: 3-925678-88-3
ISBN 13: 978-3-925678-88-2
Die Ethik der Nassrasur
Erzählungen
Manutius Verlag Heidelberg
160 Seiten
ISBN 10: 3-925678-70-0
ISBN 13: 978-3-925678-70-7
O.R
Gedichte
Manutius Verlag Heidelberg
132 Seiten
ISBN 10: 3-925678-26-3
ISBN 13: 978-3-925678-26-4
Notizen zur deutschen Einheit
Manutius Verlag Heidelberg
82 Seiten
ISBN 10: 3-925678-47-6
ISBN 13: 978-3-925678-47-9
Kunsterfahrung als
Weltverstehen
Die ästhetische Form von
»Wilhelm Meisters Lehrjahre«
Carl Winter Universitätsverlag
246 Seiten
ISBN 978-3-533-03522-0